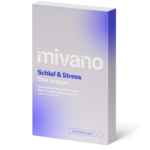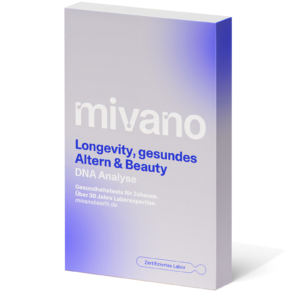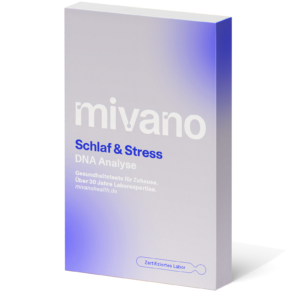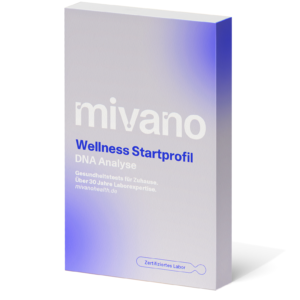Welche sind die häufigsten Erbkrankheiten?

Veröffentlicht: 25/08/2025
Zuletzt aktualisiert: 12/01/2026
Erbkrankheiten entstehen durch Veränderungen im Erbgut, die von unseren Eltern vererbt werden. Genetische Erkrankungen beeinflussen, wie unser Körper wächst, funktioniert oder sich gegen Krankheiten schützt. Einige sind schon bei der Geburt oder im Kindesalter sichtbar, andere treten erst später auf. Oft spielen neben der genetischen Veranlagung auch der Lebensstil und die Umwelt eine Rolle.
DNA-Tests können dabei helfen, das Risiko für genetisch bedingte Krankheiten frühzeitig zu erkennen und ihnen rechtzeitig entgegenzuwirken. Lesen Sie hier, was die häufigsten Erbkrankheiten sind, wie sie entstehen und wie sie sich durch moderne Gentests nachweisen lassen.
Liste: Was sind die häufigsten Erbkrankheiten im Überblick?
- Mukoviszidose
- Phenylketonurie
- Hämophilie („Bluterkrankheit“)
- Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
- Sichelzellanämie
- Chorea Huntington
- Albinismus
- Zystennieren
- Alpha-1-Antitrypsinmangel
- Neurofibromatose
- Kretinismus
- Turner-Syndrom
- Klinefelter-Syndrom
- Down-Syndrom (Trisomie 21)
Was sind Erbkrankheiten und wie entstehen sie?
Als Erbkrankheit bezeichnet man eine Erkrankung, die aus einer Veränderung mindestens eines Gens oder Allels im Erbgut entsteht und meist über die Chromosomen weitergegeben wird. Sie werden auch hereditäre Krankheiten genannt und können verschiedene Ursachen und Ausprägungen haben. Sie lassen sich in diese Kategorien einteilen:
- Vererbte Mutationen: Sie werden autosomal oder über das X-Chromosom von Eltern auf Kinder übertragen. Eltern können Träger einer Genmutation sein, ohne selbst Symptome zu zeigen.
- Spontane Mutationen: Die Veränderungen entstehen neu in der Ei- oder Samenzelle eines Elternteils und werden an das Kind weitergegeben.
- Mutationen nach der Befruchtung: Während der frühen Zellteilung kann das Erbgut des Kindes sich ebenfalls verändern.
Ob und wie stark eine Gendefekt-Symptomatik auftritt, hängt oft vom individuellen Erbgut, dem Lebensstil (z. B. Ernährung), Umweltfaktoren oder Stress ab. Nicht jede Mutation macht krank. Viele bleiben unbemerkt, andere Risikogene wirken sich auf die Entwicklung, Organe, den Stoffwechsel oder sogar die Fähigkeit zur Nährstoffverarbeitung aus.
Welche Arten von hereditären Erkrankungen gibt es?
Erbkrankheiten werden in der Humangenetik in drei Hauptgruppen unterteilt, je nach Ursache und Art des Gendefekts. Zu ihnen gehören Chromosomenstörungen, monogene Defekte und multifaktorielle Störungen.
Chromosomenveränderungen
Chromosomale Krankheiten entstehen beim Menschen durch eine veränderte Anzahl oder Struktur der Chromosomen. Bekannte Beispiele für Chromosomenstörungen des Erbguts sind:
- Trisomie 21: Beim Down-Syndrom tritt das Chromosom 21 dreimal auf, sodass statt der 46 Chromosomen beim Menschen 47 vorhanden sind. Das kann zu Entwicklungsverzögerungen, den charakteristischen Gesichtszügen und sogar zu gesundheitlichen Problemen wie Herzfehlern führen.
- Turner-Syndrom: Es tritt auf, wenn einer Frau ein X-Chromosom ganz oder teilweise fehlt. Das führt häufig zu Kleinwuchs, Unfruchtbarkeit und Herz- oder Nierenproblemen.
- Klinefelter-Syndrom: Bei der Erkrankung hat ein Mann ein zusätzliches X-Chromosom (XXY) anstelle von (XY). Ein verminderter Testosteronspiegel, eine verzögerte Pubertät und Lernschwierigkeiten können die Folgen sein.
- Cri-du-chat-Syndrom: Es wird durch ein fehlendes Stück des Chromosoms 5 verursacht. Dabei kann es zu Entwicklungsverzögerungen, auffälligen Gesichtszügen und katzenartigen Schreien bei Säuglingen kommen.
Monogene Erkrankungen
Hier handelt es sich um die Veränderung eines einzigen Gens. Die Vererbung erfolgt entweder durch einen Elternteil (autosomal dominant), durch beide Elternteile (autosomal rezessiv) oder X-chromosomal. Letzteres bedeutet, dass die Genmutation sich auf dem X-Chromosom befindet und Mädchen und Jungen unterschiedlich betrifft. Wichtige Beispiele für monogene Krankheiten sind:
- Mukoviszidose: Sie bewirkt, dass sich zäher, klebriger Schleim in der Lunge und im Verdauungssystem ansammelt. Das erschwert sowohl das Atmen als auch die Nährstoffaufnahme.
- Phenylketonurie: Der Körper kann eine Aminosäure nicht abbauen, was die Gehirnentwicklung stört.
- Sichelzellenanämie: Rote Blutkörperchen sind fehlgeformt, zerfallen leicht und blockieren den Blutfluss. Das führt zu Schmerzen, Anämie, Infektionen und sogar Organschäden.
- Hämophilie: Die Bluterkrankheit führt zu einer gestörten Blutgerinnung, wodurch starke Blutungen und Schwierigkeiten entstehen, selbst kleinerer Verletzungen zu heilen. Sie wird meist X-chromosomal vererbt: Männer erkranken, während Frauen in der Regel Trägerinnen sind und selten selbst Symptome zeigen.
- Huntington-Krankheit: Eine Erkrankung des Gehirns, die im Erwachsenenalter auftritt und im Laufe der Zeit die Bewegungsfähigkeit, das Denkvermögen und die Emotionen beeinträchtigt.
- Familiäre Hypercholesterinämie: Sie verursacht von Geburt an einen sehr hohen Cholesterinspiegel, wodurch das Risiko für frühzeitige Herzerkrankungen steigt.
- Tay-Sachs-Krankheit: Schädliche Substanzen sammeln sich im Gehirn und in den Nervenzellen an und verursachen somit fortschreitende Nervenschäden, Entwicklungsverzögerungen und in schweren Fällen den frühen Tod.
Es gibt noch viele weitere Erkrankungen wie Morbus Fabry und das Rubinstein-Syndrom. Sie sind selten, aber schwerwiegend und können unterschiedliche Symptome auslösen. Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ist größtenteils angeboren und wird durch mehrere Gene und Umweltfaktoren verursacht.
Multifaktorielle Krankheiten
Hier wirken genetische Veränderungen, Lebensstil und Umweltfaktoren zusammen. Wenn bereits ein Gendefekt in der Familie aufgetaucht ist, erhöht sich das Risiko, zu erkranken. Allerdings können selbst Menschen mit ähnlichen Genen je nach ihrer Ernährung, Bewegung und Umwelteinflüssen unterschiedliche Symptome zeigen. Beispiele sind folgende Erkrankungen:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Das Risiko ist vererbbar und kann durch eine ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel oder Rauchen verschlimmert werden.
- Typ-2-Diabetes: Hierbei verarbeitet der Körper Insulin nicht richtig, was zu einem hohen Blutzuckerspiegel führt. Obwohl dies mit erblichen Faktoren zusammenhängt, haben Ernährung, Gewicht und sportliche Aktivitäten einen starken Einfluss darauf, ob sich die Genkrankheit Diabetes Typ 2 entwickelt.
- Krebserkrankungen: Brustkrebs (BRCA-Mutation), Darmkrebs (Lynch-Syndrom), aber auch äußere Einflüsse beeinflussen das Erkrankungsrisiko.
- Asthma: Die Atemwege entzünden und verengen sich hierbei, was zu Keuchen, Atemnot und Husten führt. Asthma kann durch eine genetische Veranlagung ausgelöst werden, aber auch Allergene oder Umweltverschmutzung spielen eine Rolle.
- Osteoporose: Eine genetische Veranlagung für schwächere Knochen kann in Kombination mit der Ernährung und Bewegungsmangel zum Ausbruch der Erkrankung führen.
Weitere Beispiele für genetisch bedingte Erkrankungen, die in Verbindung mit individuellen Risikofaktoren zustande kommen, sind die Epilepsie oder die Hüftdysplasie.
Wie funktioniert ein DNA-Test bei Erbkrankheiten?
Bei einem Gentest wird die DNA einer Person analysiert, um Mutationen ihres Erbguts und Gendefekte zu erkennen. Der Test kann Aufschluss darüber geben, ob jemand eine Erbkrankheit hat, das Gen dafür trägt oder ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten aufweist – beispielsweise, wenn sie bereits gehäuft in der Familie auftritt.
Der Ablauf des Gentests ist einfach: Eine Speichel-, Gewebe- oder Blutprobe wird entnommen und an ein Labor geschickt, wo die DNA mit speziellen Geräten analysiert wird. Bei der Untersuchung kann sicher nachgewiesen werden, ob genetisch bedingte Krankheiten, vererbbare Syndrome, Genmutationen und Chromosomenanomalien vorhanden sind, was der Trägerstatus ist und welche Maßnahmen zur Vorbeugung Betroffene unternehmen können.
Welche Erbkrankheiten kann ein Gentest zuverlässig nachweisen?
Moderne DNA-Tests erkennen viele genetische Erbkrankheiten und Risikofaktoren. Zu ihnen zählen:
- Krebs: Mutationen in Genen wie BRCA1 und BRCA2 (vererbbare Veranlagung für Brust- und Eierstockkrebs), Gene, die mit dem Lynch-Syndrom in Verbindung stehen (Darm- und Gebärmutterkrebs)
- Cholesterin-Erkrankungen: Ein Beispiel hierfür ist familiäre Hypercholesterinämie.
- Neurologische Störungen: z. B. Huntington-Krankheit
- Bluterkrankungen: Sichelzellanämie, Thalassämie
- Stoffwechselkrankheiten: Hereditäre Hämochromatose (führt zu einer übermäßigen Eisenansammlung im Körper), Mukoviszidose, Phenylketonurie (gestörter Stoffwechsel der Aminosäure Phenylalanin)
- Seltene Syndrome: Rubinstein-Syndrom, Morbus Fabry
Welche DNA-Testarten gibt es zur Untersuchung von Erbkrankheiten?
Gentests können zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Methoden eingesetzt werden, um mögliche Risiken von Neugeborenen oder sogar Ungeborenen zu messen. Zu den bekannten Tests gehören:
- Neugeborenen-Screening: Schnelle Diagnose direkt nach der Geburt, sodass mögliche Behandlungen sofort eingeleitet werden können
- Trägerdiagnostik: Sie zeigt, ob jemand ein gesunder Genträger für eine Krankheit sein kann, die möglicherweise an Nachkommen weitergegeben wird.
- Diagnostische Gentests: Wenn es Symptome gibt, können diese Tests eine Veranlagung bestätigen oder ausschließen.
- Prädiktive oder präsymptomatische Tests: Sie stellen fest, ob bei einer Person im Laufe ihres Lebens mit hoher Wahrscheinlichkeit eine genetisch bedingte Erkrankung auftreten wird.
- Pränatale Tests: Während der Schwangerschaft können bestimmte genetische Erkrankungen beim ungeborenen Kind festgestellt werden.
Warum sollten Sie Ihre genetischen Risiken kennen?
Wer seine genetische Veranlagung kennt, kann frühzeitig Gegenmaßnahmen treffen. Zu ihnen gehören regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, eine gezielte Änderung der Essens- oder Bewegungsgewohnheiten und medizinische Beratung. DNA-Tests helfen dabei, informierte Entscheidungen für Gesundheit und Prävention zu treffen.