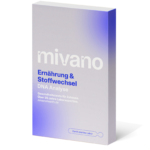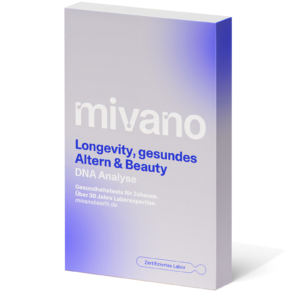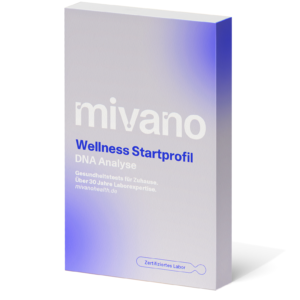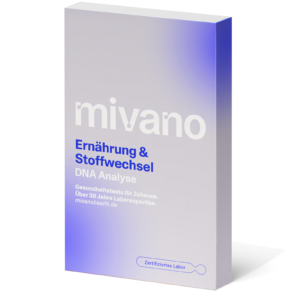Lieber süß oder salzig? Wie Gene den Geschmackssinn prägen
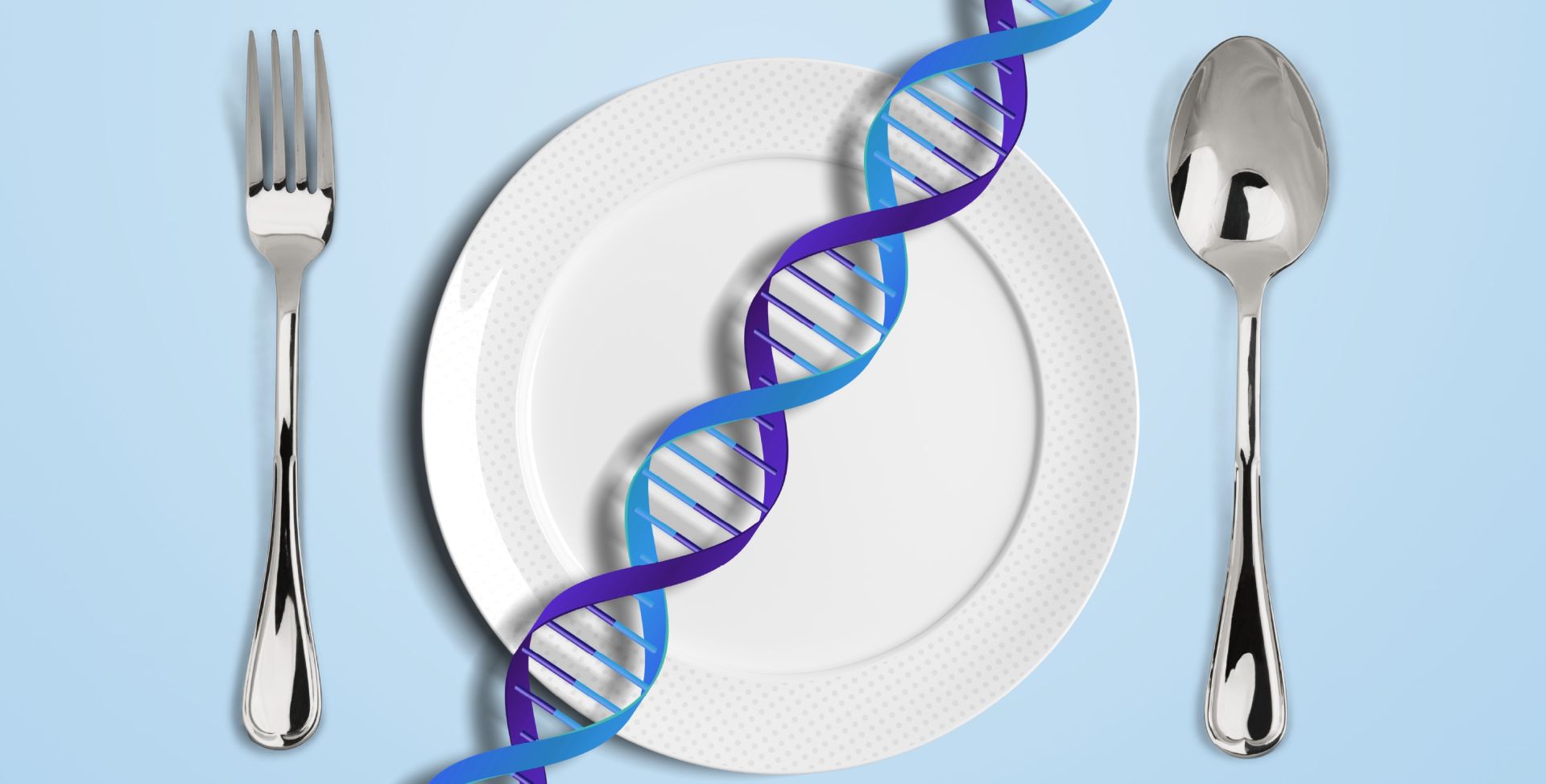
Veröffentlicht: 08/09/2025
Zuletzt aktualisiert: 15/12/2025
Ob jemand lieber süß oder salzig isst, ist nicht ausschließlich eine bewusste Entscheidung: Die Wissenschaft zeigt nämlich, dass unsere Gene eine große Rolle beim Geschmackssinn spielen. Sie erklären, warum einige Menschen bestimmte Geschmacksrichtungen bevorzugen, die andere nicht gern mögen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Geschmacksknospen auf der Zunge funktionieren, wie die DNA und Lebensweise unseren Geschmack prägen und ob sich der Geschmackssinn verändern lässt.
Was ist das Wichtigste zu DNA und Geschmackssinn?
- Bedeutung: Die Zunge kann mit ihren Geschmacksknospen fünf verschiedene Geschmacksrichtungen erkennen: süß, salzig, bitter, sauer und umami.
- DNA-Einfluss: Unsere Gene beeinflussen, wie empfindlich die Geschmackssinneszellen und Geschmacksrezeptoren unserer Zunge sind.
- Umwelt: Die Kultur, Umgebung und der regelmäßige Kontakt mit Lebensmitteln prägen den Geschmackssinn und können die genetischen Anlagen überlagern.
Wie funktioniert der Geschmackssinn?
Der Geschmackssinn entsteht durch ein Zusammenspiel aus Zunge, Nase und Gehirn. Beim Essen lösen sich durch den Speichel Teilchen aus den Nahrungsmitteln Reaktionen an den rund 10 bis 50 Sinneszellen jeder Geschmacksknospe auf der Zunge aus, die eingebettet in verschiedene Geschmackspapillen liegen. Die Papillen befinden sich auf der gesamten Zunge. Besonders viele Pilzpapillen gibt es an der Zungenspitze und am -rand. Zudem befinden sich am Zungengrund zum Rachen hin Wallpapillen und Blätterpapillen an der Seite. In jeder Papille befinden sich etwa 3 bis 5 Geschmacksknospen.
Jede Geschmackspapille trägt zahlreiche Sinneszellen, welche auf unterschiedliche chemische Stoffe reagieren und jeweils die spezifischen Geschmacksqualitäten – wie süß, salzig, bitter, sauer oder umami – erkennen können. Diese Sinneszellen reagieren auf chemische Stoffe und leiten das Signal über Nervenzellen ans Gehirn weiter.
Das Gehirn verarbeitet die Informationen aus den Geschmacksrichtungen und verbindet sie mit Gerüchen und der Wahrnehmung von Konsistenz. So entsteht eine vollständige und individuelle Geschmackswahrnehmung. Die Zunge ist dabei verantwortlich für die fünf Grundgeschmacksrichtungen, aber erst der Geruchssinn ergänzt die Aromen und macht unser Schmecken einzigartig.
Welche Geschmacksrichtung gibt es?
Die meisten Mahlzeiten sind ein Zusammenspiel aus mehreren Geschmacksqualitäten, die sich im Gehirn zu einer gustatorischen Wahrnehmung verbinden. Wir können 5 grundlegende Geschmacksrichtungen unterscheiden:
- Süß: Die Geschmacksrichtung stammt vor allem von Zucker und Kohlenhydraten, wie sie in Obst, Honig oder Süßigkeiten vorkommen. Süß wird von den meisten Menschen als angenehm empfunden und zeigt uns kalorienreiche Lebensmittel an.
- Salzig: Der Geschmack entsteht durch Salze, insbesondere Natrium, das in Speisesalz, Nüssen und manchen Gemüsesorten enthalten ist.
- Sauer: Hier reagieren die Sinneszellen auf Säuren, zum Beispiel aus Zitronen oder Essig. Sauer signalisiert häufig Reife, kann aber auch vor verdorbener Nahrung warnen.
- Bitter: Dunkle Schokolade, Kaffee, viele Kräuter und Blattgemüse schmecken bitter. Der Geschmack kann vor giftigen Stoffen schützen. Die meisten Bitterstoffe sind allerdings genießbar und in kleinen Mengen gesund.
- Umami: Das ist der „herzhafte“ Geschmack, den wir von Fleisch, Tomaten, Pilzen, Soja oder Käse kennen. Umami entsteht durch Aminosäuren wie Glutamat und sorgt für einen vollen Geschmack in vielen Gerichten. Glutamat wird oft als Geschmacksverstärker verwendet.
Wie beeinflussen Gene die Geschmackssinne?
Die Genetik bestimmt mit, wie empfindlich unsere Geschmacksrezeptoren sind. Studien wie Genetic and Environmental Determinants of Bitter Perception and Sweet Preferences beweisen, dass manche Menschen süß oder bitter besonders intensiv schmecken, andere kaum. So entstehen individuelle Vorlieben und Abneigungen.
Kleine Unterschiede in der DNA beeinflussen, wie die Rezeptoren der Zunge chemische Stoffe aus Nahrungsmitteln erkennen. Schon winzige Veränderungen durch Vererbung oder Mutation bewirken, wie wir Geschmack wahrnehmen – und ob bestimmte Speisen angenehm oder gar nicht schmecken. Manche Menschen sind dadurch wählerischer beim Essen.
Aber Gene sind nicht alles: Auch die Kultur, unsere Umgebung und Essgewohnheiten verändern den Geschmackssinn über die Jahre epigenetisch. So liegt es an einer Mischung aus Veranlagung und Erfahrung, was wir mögen.
Welche Gene beeinflussen unsere Geschmacksvorlieben?
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass verschiedene Gene beeinflussen, wie wir Geschmacksstoffe wahrnehmen. Die Literaturstudie Genetic Background of Taste Perception, Taste Preferences, and Its Nutritional Implications hat anhand von 103 wissenschaftlichen Artikeln die wichtigsten Gene für den Geschmackssinn herausgestellt. Sie steuern die Wahrnehmung von süß, bitter, Fett oder sogar Schärfe:
| Gen | Bedeutung |
| TAS2R38 | Es beeinflusst die Wahrnehmung von bitterem Geschmack, etwa bei Brokkoli, Grünkohl oder Kaffee. Personen mit bestimmten Variationen empfinden diese Lebensmittel möglicherweise als extrem bitter. |
| TAS2R16 | Es steht ebenfalls mit bitterem Geschmack im Zusammenhang und kann sich auf die allgemeine Gesundheit auswirken. |
| TAS1R2, FGF21, ATP10B, SERPINA1 | Die Gene stehen in Verbindung mit Heißhunger und „Naschkatzen“ – Menschen mit einer besonderen Vorliebe für Zucker und Süßes. |
| ALDH2 | Beeinflusst, wie wir Alkohol schmecken. |
| TAS1R1 | Steuert die Wahrnehmung von herzhaften, umami-Geschmäckern. |
Wie entwickeln sich unsere Geschmäcker im Lauf des Lebens?
Geschmacksvorlieben entstehen nicht von heute auf morgen. Sie werden durch die Umwelt und Gewohnheiten geprägt. Zwar beeinflussen Gene, ob wir auf Geschmacksstoffe empfindlich reagieren, aber häufig entscheidet, wie oft wir Nahrungsmittel essen, darüber, ob wir sie mögen.
Kinder lehnen bitteres Gemüse wie Brokkoli oft ab und gewöhnen sich erst mit der Zeit daran. Das zeigen Studien wie The importance of exposure for healthy eating in childhood. Erwachsene können wiederum beispielsweise den Geschmack von Kaffee oder dunkler Schokolade durch wiederholtes Probieren mögen lernen. Wer immer wieder neue Lebensmittel kostet, verändert sein Geschmacksempfinden.
Welche Rolle spielen Kultur und Umgebung beim Schmecken?
Essgewohnheiten aus Familie, Region und Kultur prägen unsere Vorlieben stark. In manchen Ländern sind fermentierte, sehr saure oder besonders würzige Speisen beliebt, in anderen gar nicht. Familie, Freunde und sogar die Medien können beeinflussen, was jemand als lecker empfindet – und auch wie viele „Geschmäcker“ ausprobiert werden.
Der Geschmack ist flexibel. Während unsere Gene die Grundlagen schaffen, trainieren Erfahrungen und Gewohnheiten den Geschmackssinn. So kann sich die Geschmackswahrnehmung im Laufe der Zeit auch verändern.
Kann man seinen Geschmackssinn trainieren?
Gene verleihen uns zwar bestimmte Neigungen, zum Beispiel eine Vorliebe für süß und salzig, aber durch die Anpassung der Ernährung und Gewohnheiten lässt sich der Geschmackssinn umstellen. Wenn man Zucker reduziert, kann Obst mit der Zeit als süßer empfunden werden. Speisen mit weniger Salz schmecken intensiver, wenn das Salz vorher über längere Zeit langsam reduziert wird. So passen sich die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge an neue Reize an.
Was hilft, den Geschmackssinn an gesundes Essen zu gewöhnen?
Mit einer konsequenten Anpassung lassen sich Ihre Sinne langsam „umprogrammieren“. So können Sie sich beispielsweise daran gewöhnen, gesunde Lebensmittel mit weniger Zucker oder Salz zu genießen. Die folgenden Tipps können Ihnen helfen:
- Reduzieren Sie Stoffe Schritt für Schritt: Reduzieren Sie Zucker oder Salz schrittweise, damit sich Ihre Geschmacksknospen umstellen können – ohne dass Sie sich eingeschränkt fühlen.
- Probieren Sie Alternativen: Würzen Sie mit mehr Vielfalt und nutzen Sie statt Salz und Zucker Kräuter, Gewürze, Zitronensaft oder Vanille.
- Essen Sie bewusst: Achten Sie auf Aromen, Konsistenz und Geschmack.
- Bleiben Sie geduldig: Der Geschmackssinn braucht Zeit, um neue Reize zu mögen.
- Experimentieren Sie mit neuen Geschmacksrichtungen: Je öfter Sie neue Speisen probieren, desto breiter wird das Geschmacksspektrum.
Möchten Sie mehr über Ihre genetischen Veranlagungen zur Ernährung erfahren? Entdecken Sie den Ernährungs- und Stoffwechsel-DNA-Test und erhalten Sie persönliche Empfehlungen für die Bedürfnisse Ihres Körpers.