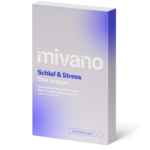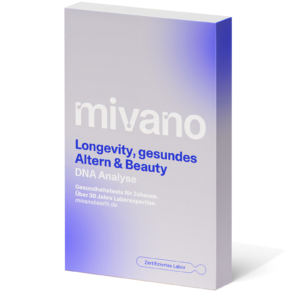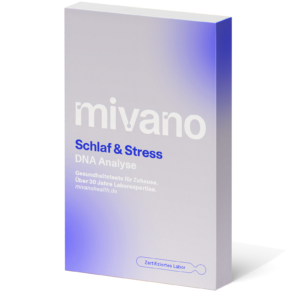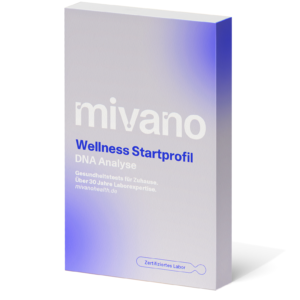Ist ADHS vererbbar? Ursachen, Symptome und Behandlung

Veröffentlicht: 08/10/2025
Zuletzt aktualisiert: 04/02/2026
Einfach mal ruhig sein? Mit ADHS ist das schwierig. Die Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitätsstörung ist eine häufige neurologische Entwicklungsstörung, die in Deutschland etwa 4,7 Prozent der Kinder und Erwachsene betrifft. Sie macht es schwer, sich zu konzentrieren, Dinge zu organisieren und geht mit Impulsivität einher. Das kann Auswirkungen auf die Schule, den Beruf und Alltag haben. Hier lesen Sie, wie sich ADHS äußert, welche Ursachen es hat und welche Rolle die Lebensweise und DNA spielen – insbesondere, ob und inwieweit ADHS vererbbar ist.
Was ist das Wichtigste zu ADHS im Überblick?
- Bedeutung: ADHS beeinträchtigt die Aufmerksamkeit, Konzentration und Selbstkontrolle bei Kindern und Erwachsenen. Die Störung beginnt häufig in der Kindheit, kann jedoch bis ins Erwachsenenalter andauern.
- Ursachen: Die Entstehung von ADHS ist komplex und umfasst Unterschiede im Gehirn, Genetik und Umwelteinflüsse.
- Genetik: Die Gene haben einen starken Einfluss auf ADHS. Eine familiäre Vorbelastung oder bestimmte Genvariationen erhöhen den Risikofaktor.
- Behandlung: Oft werden Medikamente mit einer Therapie, einer Umstellung des Lebensstils und professioneller Unterstützung kombiniert, um die Symptome effektiv zu bewältigen.
Was ist ADHS?
Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Sie ist eine neurobiologische Erkrankung, die beeinflusst, wie das Gehirn Aufmerksamkeit, Motivation und Impulskontrolle reguliert. Menschen mit ADHS fällt es häufig schwer, sich länger zu konzentrieren, Aufgaben zu planen oder zu beenden. Manche sind besonders unruhig, handeln impulsiv oder haben Schwierigkeiten, Reize zu filtern.
Die ADHS-Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein – von leichten Konzentrationsproblemen bis zu starkem Aufmerksamkeitsdefizit. Manchmal kommt ADHS gemeinsam mit weiteren Erkrankungen vor, etwa mit Depressionen, Angststörungen, Autismus oder dem Tourette-Syndrom. Bei vielen Betroffenen beginnt die Erkrankung im Kindesalter und bleibt im Erwachsenenalter, insbesondere bei Frauen, oft lange unerkannt.
Was sind häufige ADHS-Symptome?
Die Anzeichen von ADHS lassen sich in drei Hauptbereiche einteilen: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Nicht alle von ADHS Betroffenen zeigen alle Merkmale, und die Intensität kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Unaufmerksamkeit: Viele haben Probleme damit, sich länger auf Aufgaben zu fokussieren, Anweisungen zu befolgen oder organisatorisch den Überblick zu behalten. Es ist typisch, häufig Dinge zu vergessen, zu verlegen oder Aufgaben zu priorisieren oder zu Ende zu bringen.
- Hyperaktivität: Kinder mit ADHS sind oft in Bewegung, zappeln, rennen oder klettern viel. Erwachsene beschreiben häufig innere Unruhe oder das Gefühl, nicht stillsitzen zu können.
- Impulsivität: Spontanes, unüberlegtes Handeln, Gespräche zu unterbrechen oder plötzliche Entscheidungen zu treffen sind klassische Anzeichen.
Was verursacht die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung?
Es gibt nicht die eine Ursache einer ADHS, denn die Krankheit entsteht aus einer Mischung genetischer, biologischer und umweltbedingter Auslöser:
- Gehirnstruktur und Neurotransmitter: Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass bei Menschen mit ADHS bestimmte Gehirnregionen anders funktionieren, die Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle steuern. Häufig ist die Signalübertragung von Botenstoffen wie Dopamin und Noradrenalin beeinträchtigt. Das erklärt viele klassische ADHS-Symptome wie Konzentrationsprobleme oder Impulsivität.
- Umwelteinflüsse: Einige Studien wie Umweltrisikofaktoren, Schutzfaktoren und periphere Biomarker für ADHS deuten darauf hin, dass Faktoren wie Tabak- oder Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, Frühgeburten oder eine geringe Sauerstoffversorgung bei der Geburt können das Risiko für ADHS erhöhen. Auch frühe Kindheitserlebnisse oder Stress spielen eine Rolle.
Wichtig ist, dass ADHS nicht durch Erziehung, Zuckerkonsum oder übermäßige Bildschirmzeit verursacht wird. Sie können zwar das Verhalten beeinflussen, lösen aber kein ADHS aus.
Inwiefern ist ADHS vererbbar?
Unter anderem haben Zwillingsstudien gezeigt, dass ADHS stark genetisch beeinflusst ist. Das zeigt etwa die Literaturstudie An Overview on the Genetics of ADHD. Etwa die Hälfte der Kinder von Eltern mit ADHS zeigen ebenfalls Symptome. Es ist auch möglich, dass die Erkrankung eine Generation überspringt.
Mehrere Gene auf der DNA wirken bei der Entstehung zusammen. Sie steuern die Aktivität von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin, die für Aufmerksamkeit, Motivation, Emotionen und die Wahrnehmung von Belohnungen wichtig sind. Varianten dieser Gene können zu einem empfindlicheren Aufmerksamkeits- und Impulskontrollsystem führen.
Das erklärt, warum ADHS familiär gehäuft auftritt und warum Menschen unterschiedlich stark betroffen. Dass sie unterschiedlich auf Medikamente reagieren, ist auch auf die Genetik zurückzuführen. Allerdings ist ADHS kein Schicksal: Forscherinnen betonen, dass die Vererbung von ADHS zwar ein bedeutender Risikofaktor ist, die Genetik aber nur einen Teil der Entwicklung darstellt. Ein erhöhtes Risiko heißt nicht automatisch, die Störung zu entwickeln, denn die Umwelt, Therapie und Training beeinflussen maßgeblich, wie stark die Symptome ausgeprägt sind.
Wie wird ADHS diagnostiziert?
Die Diagnostik stützt sich nicht auf einen einzelnen Test, sondern auf eine umfassende Beurteilung durch medizinische Fachkräfte. Sowohl für ADHS bei Erwachsenen als auch bei Kindern werden verschiedene Verfahren kombiniert, um das Aufmerksamkeitsdefizit und die Impulskontrolle sorgfältig zu bewerten.
- Klinische Untersuchung: Ärztinnen oder Psychologen prüfen die Krankengeschichte, familiäre Vorerkrankungen und den allgemeinen Gesundheitszustand. Dabei wird auch erfasst, wie lange die ADHS-Symptome bestehen und in welchen Lebensbereichen sie auftreten.
- Verhaltensbewertungen: Standardisierte Fragebögen, strukturierte Interviews und Alltagsbeobachtungen helfen, Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität einzuschätzen. Lehrer, Eltern oder Partner können dabei wichtige Hinweise liefern.
- Ausschluss anderer Erkrankungen: Da ähnliche Symptome auch bei Angststörungen, Depressionen, Autismus oder Schlafproblemen vorkommen können, schließt die ADHS-Diagnose andere Ursachen gezielt aus.
Genetische Tests werden nicht zur direkten Diagnostik verwendet, spielen aber in der Forschung eine Rolle. Sie unterstützen aber das Verständnis, wie bestimmte genetische Varianten im Dopamin- oder Serotoninhaushalt zur Entstehung der Erkrankungen beitragen können.
Wie wird die Erkrankung behandelt?
Auch wenn ADHS nicht heilbar ist, lässt sie sich gut behandeln. Die Therapie wird je nach Alter, Lebenssituation und Schweregrad der Symptome angepasst.
- Medikamente: In vielen Fällen werden Stimulanzien oder nicht stimulierende Präparate eingesetzt, die den Dopaminspiegel im Gehirn beeinflussen. Sie können dabei helfen, die Konzentration zu verbessern, Impulsivität zu kontrollieren und Hyperaktivität zu senken.
- Verhaltenstherapie: Diese Form der ADHS-Therapie fördert die organisatorischen Fähigkeiten, hilft bei der Verhaltenssteuerung und stärkt das Selbstmanagement. Kinder, Jugendliche und Erwachsene profitieren gleichermaßen von strukturierter Begleitung und regelmäßigem Feedback.
- Lebensstil-Anpassung: Routinen, Erinnerungsfunktionen und klare Tagesstrukturen erleichtern den Alltag. Dabei können die Familie, Lehrkräfte und Kolleginnen die Betroffenen wesentlich dabei unterstützen, neue Gewohnheiten beizubehalten.
- Ergänzende Strategien: Bewegung, Achtsamkeitsübungen, gesunder Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und das Einschränken von Bildschirmzeit verbessern sowohl die Konzentration als auch das Wohlbefinden.
Wie ist die Prognose bei ADHS?
Mit einer frühen Diagnose und einer konsequenten Behandlung kann sich die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern. Viele Kinder lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen und Erwachsene entwickeln Strategien, um ihre Arbeit und Beziehungen erfolgreich zu gestalten.
Bei rund einem Drittel der Betroffenen schwächen sich die Symptome im Laufe der Jahre ab oder verschwinden teilweise ganz. Es ist entscheidend, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, sich realistische Ziele zu setzen und Unterstützung im Umfeld zu haben – etwa durch die Familie, Pädagogen oder Arbeitskolleginnen.
Zwar erteilen wir keine ADHS-Diagnosen, aber wir helfen Ihnen, mehr über Ihre psychischen Neigungen zu lernen. Der Stress-DNA-Test analysiert Ihre spezifischen Genotypen und zeigt Ihnen mögliche Veranlagung für Stimmungsschwankungen, Stress und bei der mentalen Gesundheit.